Ist der Apfel faul, wenn die Birne riecht?
Eine Erwiderung auf Ulrich Kohlers Aufsatz
"Zur Attraktivität der GRÜNEN bei älteren Wählern"*
Markus Klein und Kai Arzheimer
Zusammenfassung: Ulrich Kohler kommt in seiner Replik auf unsere Analyse der Wählerschaft der Partei DIE GRÜNEN (Klein und Arzheimer 1997) zu dem Schluß, daß die programmatische Pragmatisierung der GRÜNEN nicht - wie von uns diagnostiziert - die älteren, sondern eher die jüngeren Wähler angesprochen habe. In dieser Erwiderung zeigen wir, daß der abweichende Befund Kohlers darauf zurückzuführen ist, daß er nicht die Wahlabsicht, sondern die Parteiidentifikation zugunsten der GRÜNEN untersucht.
I. Einleitung
Ulrich Kohler irrt bereits im Titel seines Aufsatzes. Dort behauptet er, die "Attraktivität der GRÜNEN bei älteren Wählern" zu untersuchen. Tatsächlich aber analysiert er als abhängige Variable nicht die Wahlabsicht sondern die Parteiidentifikation. Diese Unterscheidung ist keine kleinliche Begriffsklauberei sondern berührt vielmehr ein grundlegendes theoretisches Problem: Bei der Wahlabsicht und der Parteiidentifikation handelt es sich um zwei grundverschiedene Konzepte der Wahlsoziologie, die aus gutem Grund separat diskutiert und analysiert werden. Kohlers Argument, daß Parteiidentifikation und Wahlabsicht gleichgesetzt werden könnten, ist weder theoretisch noch empirisch haltbar. Bereits allein aus diesem Grund kann seine Analyse unsere Befunde nicht entwerten. Da Kohler in seinem Beitrag gleichwohl behauptet, unsere Analysen empirisch widerlegt zu haben, werden wir diesen Aspekt im folgenden noch weiter ausführen. Darüber hinaus formuliert Kohler aber auch Kritikpunkte an unserer Analyse, die wir für diskussionswürdig halten. Dies sind die vermeintlich unangemessene Spezifikation des Kohortenmechanismus sowie die vermeintlich unangemessene Datenbasis. Wir wollen zu diesen beiden Punkten im folgenden Stellung nehmen, obgleich wir glauben, daß die Unterschiede in den substantiellen Befunden letztlich auf die Unterschiede in der abhängigen Variable zurückgeführt werden müssen.
| Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Text nicht um die endgültige Druckfassung, sondern um ein Manuskript. Bitte zitieren Sie deshalb nur nach der gedruckten Fassung! |
II. Die vermeintlich ungeeignete Spezifikation des Kohortenmechanismus
Sowohl unsere als auch die Analyse Ulrich Kohlers beschäftigt sich mit der These vom "Ergrauen der GRÜNEN" (Bürklin/Dalton 1994). Mit dieser Metapher werden zwei Prozesse bezeichnet: Die Tatsache, daß die Wähler der GRÜNEN immer älter werden, sowie die Entwicklung der GRÜNEN hin zu einer pragmatischen Reformpartei. Für das Ergrauen der grünen Wähler als Makrophänomen lassen sich zwei Erklärungen auf der Mikroebene anführen. Die These von der generationalen Wasserscheide geht davon aus, daß die ursprünglich sehr jungen Erstwähler der GRÜNEN im Lebensverlauf ihre Parteipräferenz im wesentlichen beibehalten, während die nachrückenden Generationen ebenfalls eine Präferenz zugunsten der GRÜNEN ausbilden, so daß das Durchschnittsalter des Elektorats insgesamt steigt. Die Lebenszyklushypothese hingegen bringt das steigende Durchschnittsalter der Wähler der GRÜNEN mit dem veränderten programmatischen Profil der Partei in Zusammenhang. Es wird angenommen, daß auf individueller Ebene die Bereitschaft zur Wahl der GRÜNEN im Lebenslauf rückläufig ist, weil bestimmte kritische Ereignisse (Berufseintritt, Familiengründung) zur Herausbildung konservativer Politikpräferenzen führen. Der programmatische Wandel der Partei habe diesen Alterseffekt allerdings im Lauf der Zeit abgeschwächt.
Um die beiden Hypothesen gegeneinander testen zu können, muß der Einfluß von Kohorten- und Alterseffekten auf die Wahl der GRÜNEN analysiert werden, unter gleichzeitiger Kontrolle von Periodeneffekten. Darüber hinaus postuliert die Lebenszyklushypothese in der oben referierten Form eine Interaktion zwischen Alters- und Periodeneffekten. Das klassische Identifikationsproblem der Kohortenanalyse stellt sich damit in verschärfter Form, denn schon ein Kohortenmodell ohne Interaktionseffekte ist unteridentifiziert, weil die drei Einflußfaktoren eine perfekte Linearkombination bilden. Eindeutige Parameterschätzungen sind deshalb nicht möglich.
Das einfache Identifikationsproblem ist technisch durch die Aufnahme von Restriktionen in das Modell lösbar. Inwieweit dies für unser komplexes Problem mit Interaktionseffekten gilt ist unklar. Unter anderem deshalb haben wir uns für eine inhaltliche Lösung entschieden: Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Geburtskohorte ist eine bloße statistische Eigenschaft und hat für sich genommen keinerlei sozialwissenschaftliche Relevanz. Entscheidend ist vielmehr, daß postmaterialistische Wertorientierungen und hohe formale Bildung als die eigentlichen erklärenden Variablen sich über die Generationensukzession ausbreiten. Deshalb haben wir statt der Generationenzugehörigkeit diese beiden Variablen in unser zentrales Modell aufgenommen.
Auch bei der Operationalisierung des Alterseffektes haben wir uns an theoretischen Überlegungen orientiert: Das Alter geht nicht als metrische Variable in die Analyse ein. Vielmehr sind wir davon ausgegangen, daß die von Bürklin (1987: 188) beschriebenen Prozesse der gesellschaftlichen Etablierung bei der überwältigenden Mehrheit der Befragten bis zum 35. Lebensjahr abgeschlossen sein dürften und haben das Alter deshalb entsprechend dichotomisiert. Es dient somit als ein Indikator für die eigentlich relevanten Integrationsprozesse. Die Operationalisierung der Periode schließlich orientiert sich an den von uns herausgearbeiteten Entwicklungsphasen der GRÜNEN.
Im Ergebnis zeigt unsere Analyse, daß neben den positiven Effekten von Bildung und Postmaterialismus, die wir im Sinne der Hypothese von der generationalen Wasserscheide interpretieren, ein deutlicher negativer Alterseffekt auftritt. Von besonderem Interesse ist ein starker Interaktionseffekt zwischen dem Alter und der Phase der "realpolitischen Dominanz". In dieser Phase reduziert sich der negative Effekt des Lebensalters auf die Wahlchancen der GRÜNEN erkennbar, während die Effekte von Postmaterialismus und Bildung konstant bleiben. Wir interpretieren diese Ergebnisse als Indiz dafür, daß das "Ergrauen der GRÜNEN" am besten durch das Zusammenwirken eines Kohorten- und eines sich tendenziell abschwächenden Alterseffektes erklärt werden kann. Die Abschwächung des Alterseffektes führen wir wiederum auf die programmatische Wandlung der Partei zurück.
Ulrich Kohler kritisiert die Verwendung des Postmaterialismus-Index als Indikator für die Generationszugehörigkeit mit dem Argument, daß möglicherweise "die verwendete Variable neben dem eigentlich interessierenden Merkmal weitere Einflußgrößen mißt" (Kohler 1998: 542). Aus seiner Sicht ist die Verknüpfung von Inglehart-Index und Generationenzugehörigkeit "eine Instrumententheorie, die sich als falsch erweisen könnte" (Kohler 1998: 545). Insbesondere bezweifelt Kohler, daß unser Analysedesign im Sinne der Fragestellung konservativ ist, d.h. daß es Kohorteneffekte tendenziell überschätzt (Klein und Arzheimer 1997: 667f.; Kohler 1998: 542-543). Seiner eigenen Analyse auf der Grundlage des SOEP sei deshalb "der Vorzug zu geben", weil das von ihm verwendete Verfahren "geringere Anforderungen an die Instrumententheorien stellt" (Kohler 1998: 545). Gegen diese Kritik lassen sich unseres Erachtens einige berechtigte Einwände vorbringen.
Zunächst ist festzuhalten, daß das von Kohler verwendete alternative Verfahren ein mindestens dreiwelliges Panel voraussetzt (Markus 1983: 727). In Deutschland existiert allerdings keine solche Panel-Studie, die den von uns untersuchten Zeitraum vollständig abdeckt und durchgängig die Frage nach der Wahlabsicht enthält. Der Ansatz von Markus ist daher aufgrund fehlender Daten auf die von uns untersuchte Fragestellung nicht anzuwenden. Daß Kohler trotzdem glaubt dies tun zu können, ist letztlich darauf zurückzuführen, daß seiner abhängigen Variablen eine "Instrumententheorie" zugrundeliegt, die mindestens so heroisch ist wie die, die er bei uns bemängelt (vgl. hierzu IV).
Zweitens ist die von uns in der Tat als gültig vorausgesetzte Hypothese der "Silent Revolution" eine der am häufigsten getesteten sozialwissenschaftlichen Theorien überhaupt. Die Kritik an ihr richtet sich vor allem gegen die inhaltliche Interpretation der Items und die Anfälligkeit gegen Periodeneffekte, die mit dem Konzept stabiler Wertorientierungen nur schwer in Einklang zu bringen ist. Als "Meßtheorie" wird von uns jedoch nur eine Teilhypothese der "Silent Revolution" verwendet, nämlich die Ausbreitung postmaterialistischer Orientierungen durch die Generationenfolge (Klein und Arzheimer 1997: 666). Dieser von Inglehart postulierte Zusammenhang zwischen Generationenzugehörigkeit und Postmaterialismusindex zeigt sich sowohl in unseren Berechnungen mit dem ALLBUS (Klein und Arzheimer 1997: 667, Tabelle 3) als auch in der von Kohler vorgenommenen Analyse des SOEP (Kohler 1998: 543, Abbildung 1). In allen Fällen nimmt der Anteil der Postmaterialisten mit jeder neuen Generation monoton zu, d.h. unbeschadet der möglichen Zweifel an der individuellen Stabilität und der inhaltlichen Bedeutung des Index ist er ein brauchbarer Indikator für die Generationenzugehörigkeit.
Drittens bemüht sich Kohler mit großem Aufwand nachzuweisen, daß unser Design möglicherweise entgegen unserer eigenen Auffassung nicht konservativ ist, d.h. daß es Kohorteneffekte nicht über-, sondern unterschätzt. Dabei übersieht er nicht nur, daß wir die formale Bildung als einen zweiten, wesentlich unproblematischeren Indikator für die Generationenzugehörigkeit verwenden, sondern vor allem, daß wir mit den von uns verwendeten Indikatoren starke Kohorteneffekte nachweisen. Seine Argumentation gegen unsere Indikatoren wäre nur dann von Relevanz, wenn wir die Hypothese der generationalen Wasserscheide aufgrund unserer Befunde verwerfen würden. Dies ist aber nicht der Fall (Klein und Arzheimer 1997: 670-671).
Viertens schließlich sind wir der Auffassung, daß ein unvollkommener, aber inhaltlich sinnvoll interpretierbarer Indikator, der einen groben Eindruck von den zugrunde liegenden sozialen Prozessen gibt, einem möglicherweise exakteren Verfahren vorzuziehen ist, das auf einer mechanischen Einordnung der Befragten in Zehn-Jahres-Kohorten beruht. Im Gegensatz zu Ulrich Kohler glauben wir nicht, daß es sinnvoll bzw. überhaupt möglich ist, sich in variablensoziologischer Manier auf die bloße "Identifikation des Wirkungsmechanismus" (Kohler 1998: 541) zu konzentrieren und die "Ursachen des Wirkungsmechanismus" außer acht zu lassen.
III. Die vermeintlich ungeeignete Datenbasis
Ulrich Kohler kritisiert unsere Datenbasis nicht explizit, verwendet für seine eigene Analyse jedoch die dreizehn Wellen des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP, 1984-1996), während wir uns auf Trenddaten, nämlich die kumulierten Politbarometer (1980-1995) und den kumulierten ALLBUS (1980-1996) stützen. Kohlers Argumente für einen Wechsel der Datenbasis - Paneldaten seien für Kohortenanalysen in besonderer Weise geeignet und zur Untersuchung der Stabilität individueller Parteipräferenzen unabdingbar (Kohler 1998: 539) - sind korrekt.
Wir haben uns bei unserer eigenen Arbeit dennoch bewußt gegen die Verwendung des SOEP entschieden. Dafür gibt es gute Gründe: Jede Panelstudie ist grundsätzlich mit dem Problem des Paneleffektes und der Panelmortalität behaftet. Letztgenanntes Problem gilt insbesondere für Langfristpanel wie das SOEP. Kohler selbst berichtet, daß 1996 "noch ca. 43 Prozent" (Kohler 1998: 539) der 1984 befragten Personen interviewt werden konnten. Hinzu kommt, daß bereits in der ersten Welle fast 40 Prozent nicht-neutrale Stichprobenausfälle auftraten (Hanefeld 1987: 184). Mit anderen Worten: 1996 umfaßte die Stichprobe nur noch etwa 26% derjenigen, die eigentlich befragt werden sollten. Diese Ausfälle dürften weitgehend systematischer Natur sein. Die Übertragbarkeit der Kohlerschen Ergebnisse auf die Grundgesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung ist deshalb in höchstem Maße fraglich. Bei Trendstudien wie dem ALLBUS hingegen summieren sich die Ausfälle der einzelnen Erhebungswellen nicht auf, weil für jedes Befragungsjahr eine neue Zufallsstichprobe gezogen wird. Darüber hinaus verwendet Kohler als Prozentuierungsbasis nur die Personen, "die eine Parteiidentifikation aufwiesen und angaben" (Kohler 1998: 547, FN 16), was eine weitere Verzerrung induziert. Durch dieses Vorgehen verändert sich außerdem auch die Prozentuierungsbasis im Zeitverlauf (Kohler 1998: 549), was Kohlers Ergebnisse zusätzlich in Frage stellt, weil noch nicht einmal die von ihm untersuchten Kohorten über die Zeit vergleichbar bleiben. Angesichts der Verzerrungen, die Kohler in seinen eigenen Analysen kommentarlos hinnimmt, erscheint seine Kritik an den vermeintlichen "Verzerrungen aufgrund schwankender Stichprobenzusammensetzungen" bei der Verwendung von Trendstudien (Kohler 1998: 553) nachgerade absurd.
Vor allem aber gilt, daß die in unserem Zusammenhang relevante abhängige Variable, nämlich die Wahlabsicht, im SOEP nicht erhoben wird, sondern nur die Parteiidentifikation. Kohler untersucht also nicht die Wähler der GRÜNEN, sondern die Gruppe der Personen, die eine grüne Parteiidentifikation aufweisen.
IV. Zum Verhältnis von Parteiidentifikation und Wahlabsicht
Kernstück der Arbeit von Ulrich Kohler ist eine Replikation der Studie von Markus (1983), die sich mit der Stärke der Parteiidentifikation im gesamten US-amerikanischen Elektorat bzw. in einigen Kohorten beschäftigt. Kohler untersucht entsprechend seiner Fragestellung den Anteil grüner Parteiidentifizierer im Elektorat bzw. in einzelnen Kohorten sowie - über Markus hinausgehend - das Vorliegen einer grünen Parteiidentifikation auf individueller Ebene. Im Ergebnis kommt Kohler zu dem Schluß, daß sich "auffällige Periodeneffekte nur bei den jüngeren Kohorten zeigen" (Kohler 1998: 553), während "das Ausmaß grüner Parteiidentifikation der Geburtenjahrgänge vor 1940 nur sehr geringfügig mit dem Erhebungsjahr variiert". Es seien also gerade "die jüngste Kohorte, die während der Phase der realpolitischen Dominanz am stärksten von den GRÜNEN angezogen wird".
Dieser Befund ist gut mit der Literatur zur Entstehung von Parteiidentifkationen vereinbar (vgl. Markus 1983: 736-737; Jennings und Markus 1984: 1003-1006). Die Parteiidentifikation ist theoretisch als eine langfristig stabile affektive Bindung an eine Partei konzeptualisiert, die sich mit steigendem Alter verfestigt und zunehmend änderungsresistent wird. Daraus folgt notwendigerweise auch, daß jüngere Kohorten, deren Parteiidentifikation noch nicht gefestigt ist, stärker durch aktuelle politische Ereignisse wie den programmatischen Wandel der GRÜNEN beeinflußt werden können. Die Befunde Kohlers sind also mehr als plausibel und stellen in unseren Augen eine aufschlußreiche Ergänzung unserer eigenen Arbeit dar. Sie stehen zu unseren Ergebnissen aber nicht notwendigerweise im Widerspruch. Untersucht man – wie wir das getan haben - die eher kurzfristige Wahlabsicht, so kann der programmatische Wandel der GRÜNEN durchaus dazu geführt haben, daß ältere Wähler nun häufiger zur Wahl der GRÜNEN neigen, auch wenn sie (noch) keine Parteiidentifikation zugunsten der GRÜNEN herausgebildet haben.
Wenn Ulrich Kohler aber in einer Fußnote (!) darauf hinweist, daß "unterschiedliche Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Operationalisierung nicht erwartet werden" (Kohler 1998: 540, FN 8), um dann im folgenden die Parteiidentifikation zu untersuchen und von Wählern zu sprechen, so zeugt das von einer Kühnheit, die nur verblüffen kann. Das Ann-Arbor-Modell, innerhalb dessen die Parteiidentifikation eine zentrale, aber keineswegs allein entscheidende Rolle spielt, ist Kohler lediglich eine weitere Fußnote wert, in der er auf das Lehrbuch von Bürklin (1988) verweist. Die umfangreiche Literatur zur Übertragbarkeit des Konzepts auf die Bundesrepublik, zur Operationalisierung, zur Stabilität des Konstrukts und vor allem zur schwindenden Bedeutung der Parteiidentifikation (Dealignment-These) läßt er in seinen Ausführungen völlig außer acht. Gestützt wird seine "Operationalisierung" lediglich durch einen Hinweis auf die Aufsätze von Kaase und Klingemann (1994) sowie von Küchler (1990). Der Aufsatz von Kaase und Klingemann beschäftigt sich allerdings mit ostdeutschen Wahlberechtigten und deren "mühsamem Weg zu einer ‘neuen’ Demokratie". Daß diese Personen zu einem großen Teil (noch) keine stabile Parteiidentifikation entwickelt haben und die Beantwortung der Parteiidentifikations-Frage deshalb stark mit der aktuellen Wahlabsicht korreliert, ist für die westdeutschen Anhänger der GRÜNEN zunächst ohne jede Relevanz. Für den Aufsatz von Küchler (1990) gilt, daß er eine Extremposition markiert und mit Sicherheit nicht für den Mainstream innerhalb der empirischen Wahlforschung steht.
Daß die Operationalisierung der Parteiidentifikation in Mehrparteiensystemen problematisch ist und die Beantwortung der Frage nach der Parteiidentifikation in größerem Umfang von aktuellen Ereignissen beeinflußt wird, kann nicht bestritten werden. Neuere, international vergleichende Studien (vgl. Schickler und Green 1997) versuchen deshalb, diese Effekte explizit zu modellieren, um so zu einer unverzerrten Schätzung der Stabilität von Parteiidentifikationen zu kommen. Ulrich Kohler ignoriert auch diese Ansätze. In letzter Konsequenz betrachtet, unterstellt er mit der Gleichsetzung von Parteiidentifikation und Wahlabsicht vielmehr implizit, daß die Messung der Parteiidentifikation mit einem systematischen Fehler von nahezu 100% behaftet ist, den er als die eigentliche abhängige Variable betrachtet. Angesichts der Besorgnis Kohlers gegenüber unseren Proxy-Variablen, ist dies mehr als verblüffend.
Vor allem aber widerspricht diese "Operationalisierung" der Wahlabsicht durch die Frage nach der Parteiidentifikation Kohlers eigenen Erkenntnissen. Er selbst kommt nämlich auf der Grundlage des SOEP zu dem Schluß, daß die "Parteiidentifikation von 1996 (...) in aller Regel dieselbe [ist] wie 12 Jahre zuvor" (Kohler 1998: 551). Kohler bestätigt also durch seine empirischen Analysen den Status der Parteiidentifikation als langfristig stabiles Konstrukt, den er kurz zuvor noch energisch in Frage gestellt hat (vgl. hierzu auch die Seiten 544, 550).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Parteiidentifikation keinesfalls mit der Wahlabsicht gleichgesetzt werden kann. Dies gilt insbesondere für die GRÜNEN. Abbildung 1 zeigt, daß die von uns untersuchten Wähler der GRÜNEN über den gesamten Analysezeitraum hinweg nur ungefähr zur Hälfte eine grüne Parteiidentifikation aufweisen. Der Anteil der Wähler mit einer grünen Parteiidentifikation geht außerdem in der Phase des Grünen Aufbruchs deutlich zurück. Dieser Befund ist mit unserer Vermutung vereinbar, daß die GRÜNEN seit diesem Zeitpunkt neue, ältere Wähler hinzugewinnen konnten, die aber (noch) keine Parteiidentifikation zugunsten der GRÜNEN aufweisen. Kohlers Befund, daß der programmatische Wandel der GRÜNEN, wenn man die Parteiidentifikation betrachtet, sich am stärksten bei der jüngsten Kohorte ausgewirkt hat, steht dazu nicht im Widerspruch.
Abbildung 1: Der Anteil der Wähler mit grüner Parteiidentifikation an allen Wählern der GRÜNEN (Bundesrepubik Deutschland, alte Bundesländer 1982-1995)
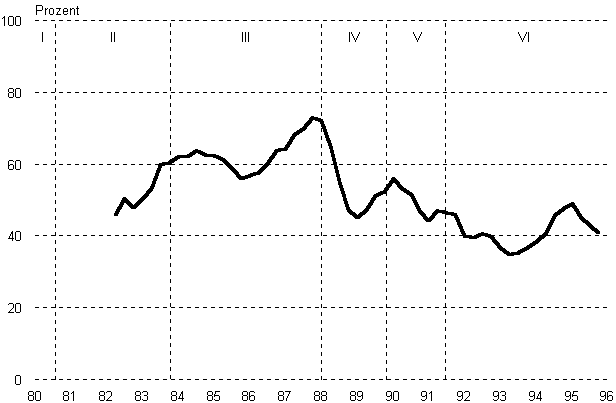
Datenbasis: Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen 1982-1995 (quartalsweise). Eingetragen sind dreigliedrige gleitende Mittel.
Anmerkung: Die vertikalen gestrichelten Linien geben die in Klein und Arzheimer 1997 entwickelte Phaseneinteilung der Geschichte der GRÜNEN wieder: I: Gründungsphase; II: Ökosozialistische Dominanz; III: Fundi-Realo-Kontroverse; IV: Grüner Aufbruch; V: Einheitsbedingte Repolarisierung; VI: Realpolitische Dominanz.
V. Fazit
Auf der Grundlage des SOEP kann Ulrich Kohler unsere Ergebnisse nicht widerlegen, weil er sich auf ein grundlegend anderes Phänomen bezieht. Parteiidentifikation und Wahlabsicht sind zwei unterschiedliche Konzepte, die – ganz besonders im Falle der GRÜNEN – auch empirisch keineswegs zusammenfallen. Wer das ignoriert, vergleicht Äpfel mit Birnen. Kohlers Schluß, daß seine abweichenden Ergebnisse einen Beleg für "die ungeeignete Spezifikation des Kohortenmechanismus bei Klein und Arzheimer" (Kohler 1998 536) darstellen, ist logisch ungültig, weil seine kaum explizit gemachte Prämisse (Kohler 1998: 540f., insbesondere FN 8) – Parteiidentifikation gleich Wahlabsicht – theoretisch nicht haltbar und empirisch falsch ist. Seine abweichenden Befunde sind vielmehr der abweichenden abhängigen Variablen geschuldet. Für diese Annahme spricht, daß Kohler dort, wo er tatsächlich Wahlverhalten untersucht (Kohler 1998: 548, Abbildung 3 untere Hälfte), zu Ergebnissen kommt, die den unseren entsprechen: Der Anteil der GRÜNEN in den jüngsten Kohorten bleibt weitgehend konstant, während er in den älteren Gruppen ansteigt. Die Kritik von Kohler an unseren Analysen ist daher ungefähr genauso legitim, wie der Versuch, vom strengen Geruch der Birne auf die Faulheit des Apfels zu schließen. Wir betrachten seine Analyse insofern als eine interessante Ergänzung unserer eigenen Arbeit, keinesfalls aber als deren Widerlegung.
Literatur
Bürklin, Wilhelm P., 1987: Governing Left Parties Frustrating the Radical Non-Established Left: The Rise and Inevitable Decline of the Greens. In: European Sociological Review 3: 109-126.
Bürklin, Wilhelm P., 1988: Wählerverhalten und Wertewandel. Opladen: Leske+Budrich.
Bürklin, Wilhelm P., und Russel J. Dalton, 1994: Das Ergrauen der Grünen. S. 264-302 in: Hans-Dieter Klingemann und Max Kaase (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1990. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Hagenaars, Jacques A., 1990: Categorical Longitudinal Data. Log-Linear Panel, Trend, and Cohort Analysis. Newbury Park u.a.: Sage.
Hanefeld, Ute, 1987: Das Sozio-ökonomische Panel. Grundlagen und Konzeption. Frankfurt: Campus.
Jennings, Kent M., und Gregory B. Markus, 1984: Partisan Orientations over the Long Haul: Results from the Three-Wave Political Socialization Study. In: American Political Science Review 78: 1000-1018.
Kaase, Max, und Klingemann, Hans-Dieter, 1994: Der mühsame Weg zur Entwicklung von Parteiorientierungen in einer "neuen" Demokratie: Das Beispiel der früheren DDR. In: Klingemann, Hans-Dieter und Kaase, Max (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1990. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 365-396.
Klein, Markus, und Kai Arzheimer, 1997: Grau in Grau. Die Grünen und ihre Wähler nach eineinhalb Jahrzehnten. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 49: 650-673.
Kohler, Ulrich, 1998: Zur Attraktivität der GRÜNEN bei älteren Wählern. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50: 536-559.
Küchler, Manfred, 1990: Ökologie statt Ökonomie: Wählerpräferenzen im Wandel? In: Kaase, Max und Klingemann, Hans Dieter (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1987. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 419-444.
Markus, Gregory B., 1983: Dynamic Modelling of Cohort Change: The Case of Political Partisanship. In: American Journal of Political Science 27: 717-739.
Schickler, Eric, und Green, Donald Philip, 1997: The Stability of Party Identification in Western Democracies. Results From Eight Panel Surveys. In: Comparative Political Studies 30: 450-483.